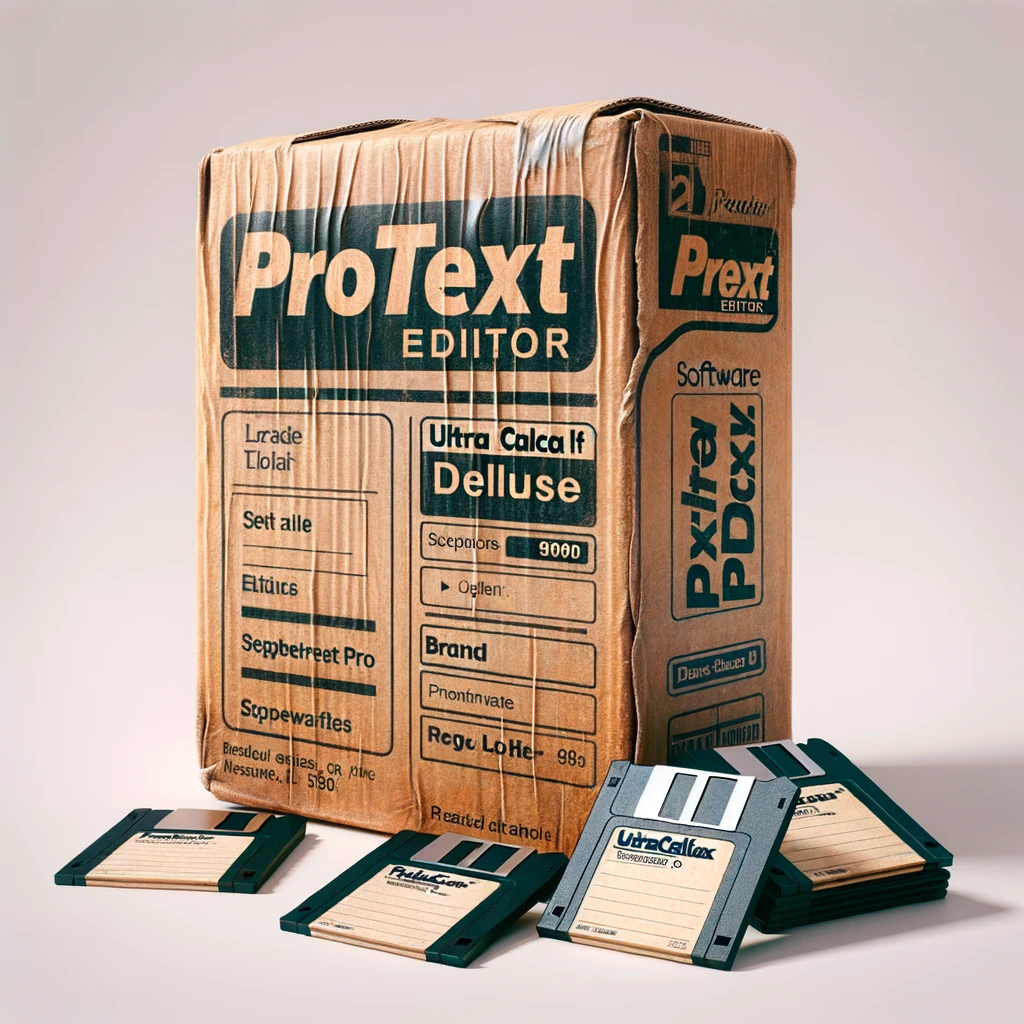Sind Ihre Verträge bereit für das nächste Jahrzehnt? Es ist ohnehin schon erschreckend, wie wenig Mühe sich Unternehmen mit Ihren Verträgen machen: Dabei beruhen hierauf doch sämtliche erzielten Umsätze.
Und nun kommt auch noch etwas ganz Neues: Von der „größten Reform des Schuldrechts seit zwei Jahrzehnten“ spricht der Beck-Verlag zu Recht zur Neuauflage des Grüneberg-BGB-Kommentars (vormals Palandt). Die Umsetzung von Digitale-Inhalte-RL, Warenkauf-Richtlinie und des Gesetzes für faire Verbraucherverträge bringen weitreichende Änderungen, die man im kaufmännischen und vertragsrechtlichen Alltag ab dem 1.1.22 kennen muss. Weitreichende Änderungen im Kaufrecht und AGB-Recht werden die Arbeit der nächsten Jahre prägen, besonders für jeden, der mit der Überlassung digitaler Produkte zu tun hat oder der mit dem An- oder Verkauf sein Geld verdient.
Neues Kaufrecht und Softwarerecht 2022 weiterlesen