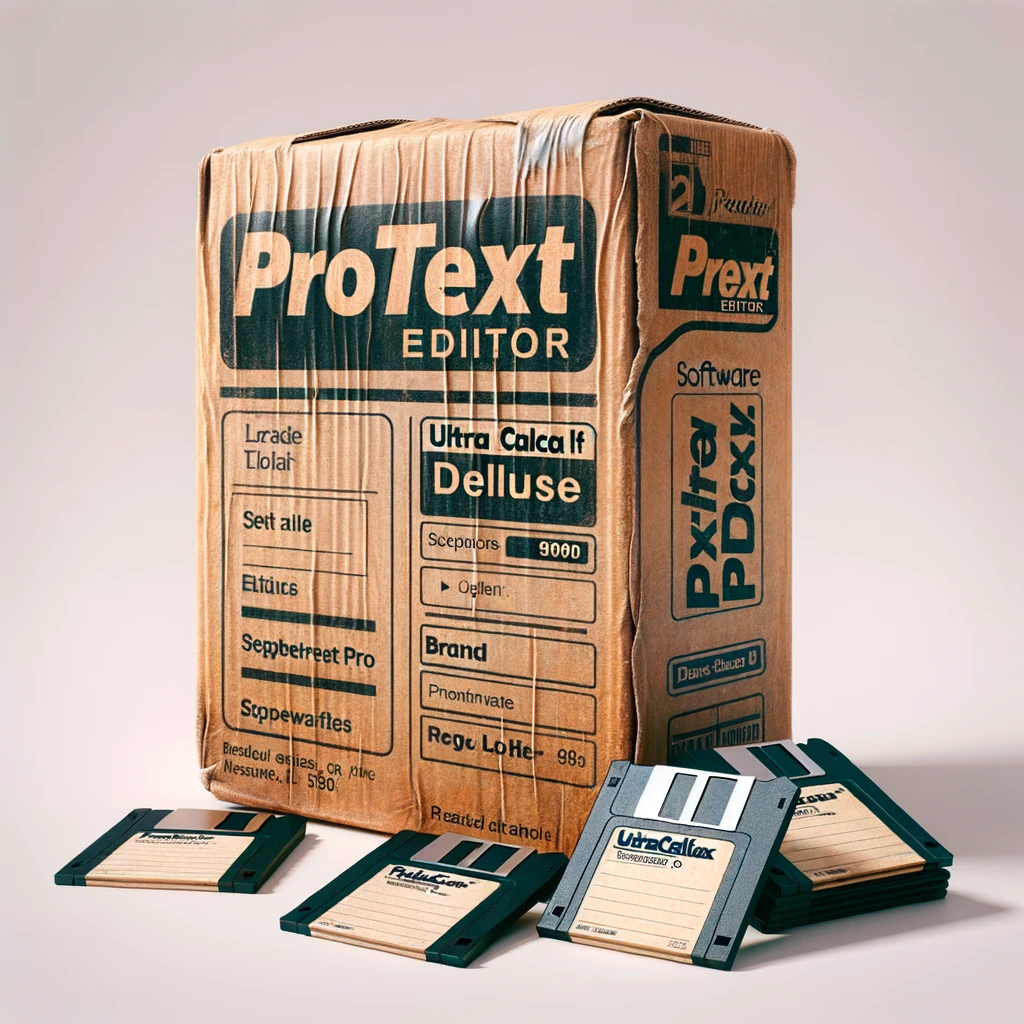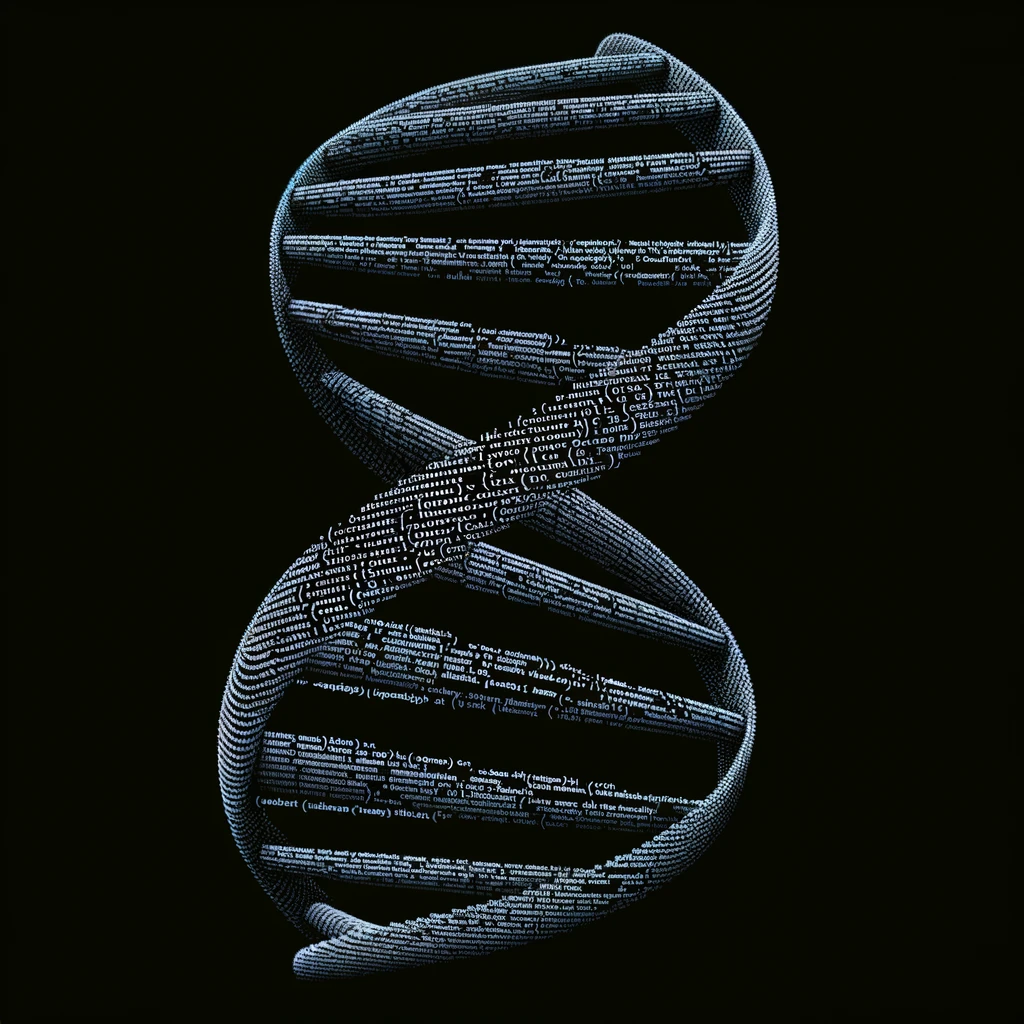Das Landgericht Hamburg (308 O 244/16) hatte 2016 entschieden, dass es einen Unterlassungsanspruch einer Nachrichtenseite gegen einen Adblocker gibt – allerdings wurde ein solcher nicht auf urheberrechtlicher, sondern nur auf wettbewerbsrechtlicher Grundlage zugestanden.
Zu den urheberrechtlichen Fragen hatte das Landgericht ausgeführt, dass eine Umarbeitung der Steuerungssoftware der Webseiten der Antragstellerin i.S.d. § 69c Nr. 2 UrhG nicht anzunehmen sei. Die Antragstellerin habe seinerzeit einen Eingriff in die Substanz des Programms nicht glaubhaft gemacht. Auch eine unzulässige Vervielfältigung des Programms sei nicht gegeben. Die Antragstellerin gestatte es den Nutzern ihres Internetauftritts gerade ohne Einschränkung hinsichtlich der Nutzung von Werbeblockern, ihr Programm in ihrem – der Nutzer – Arbeitsspeicher abzulegen.
Später dann, im Jahr 2018, hatte sich das Hanseatische Oberlandesgericht Hamburg (5 U 46/17) damit zu beschäftigen, konnte dazu aber nichts weiter ausführen, da der von der Antragstellerin ursprünglich auf die Verletzung von Urheberrechten gestützte Verfügungsanspruch vom Landgericht (formell) rechtskräftig zurückgewiesen worden und dementsprechend nicht Gegenstand des Berufungsverfahrens geworden war. Auch der Bundesgerichtshof (I ZR 154/16) konnte sich damit beschäftigen, stellte am Rande fest, dass wohl keine grundsätzlichen urheberrechtlichen Bedenken bestehen und jedenfalls ein wettbewerbsrechtlicher Unterlassungsanspruch nicht zu erkennen ist:
- Das Angebot einer Software, die Internetnutzern ermöglicht, beim Abruf mit Werbung finanzierter Internetangebote die Anzeige von Werbung zu unterdrücken, ist keine unlautere zielgerichtete Behinderung im Sinne des § 4 Nr. 4 UWG. Dies gilt auch, wenn das Programm die Freischaltung bestimmter Werbung solcher Werbetreibender vorsieht, die dem Anbieter des Programms hierfür ein Entgelt entrichten.
- Das Angebot einer Werbeblocker-Software stellt auch keine aggressive geschäftliche Handlung im Sinne des § 4a Abs. 1 UWG gegenüber den Unternehmen dar, die an der Schaltung von Werbung interessiert sind.
Insgesamt wird damit eine grundsätzliche Zulässigkeit von Adblocker-Sofware im Raum stehen.