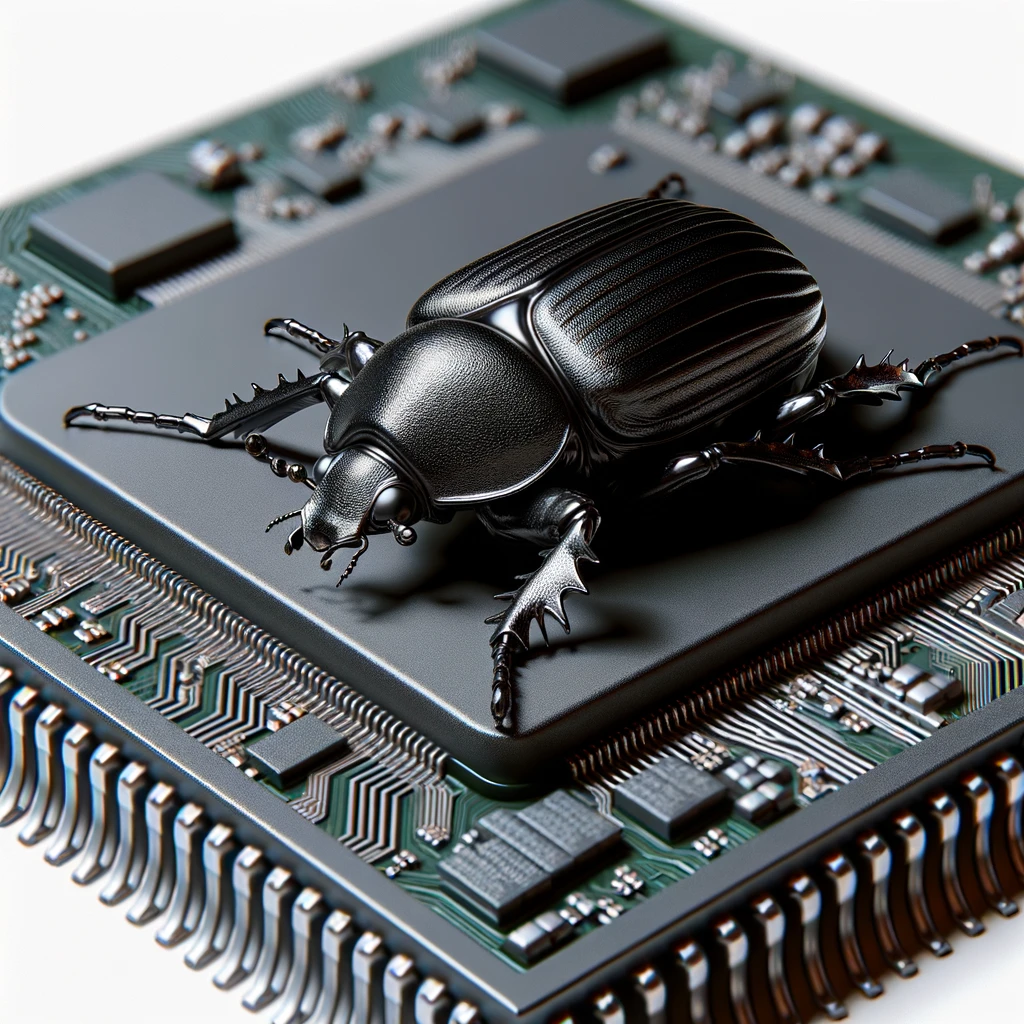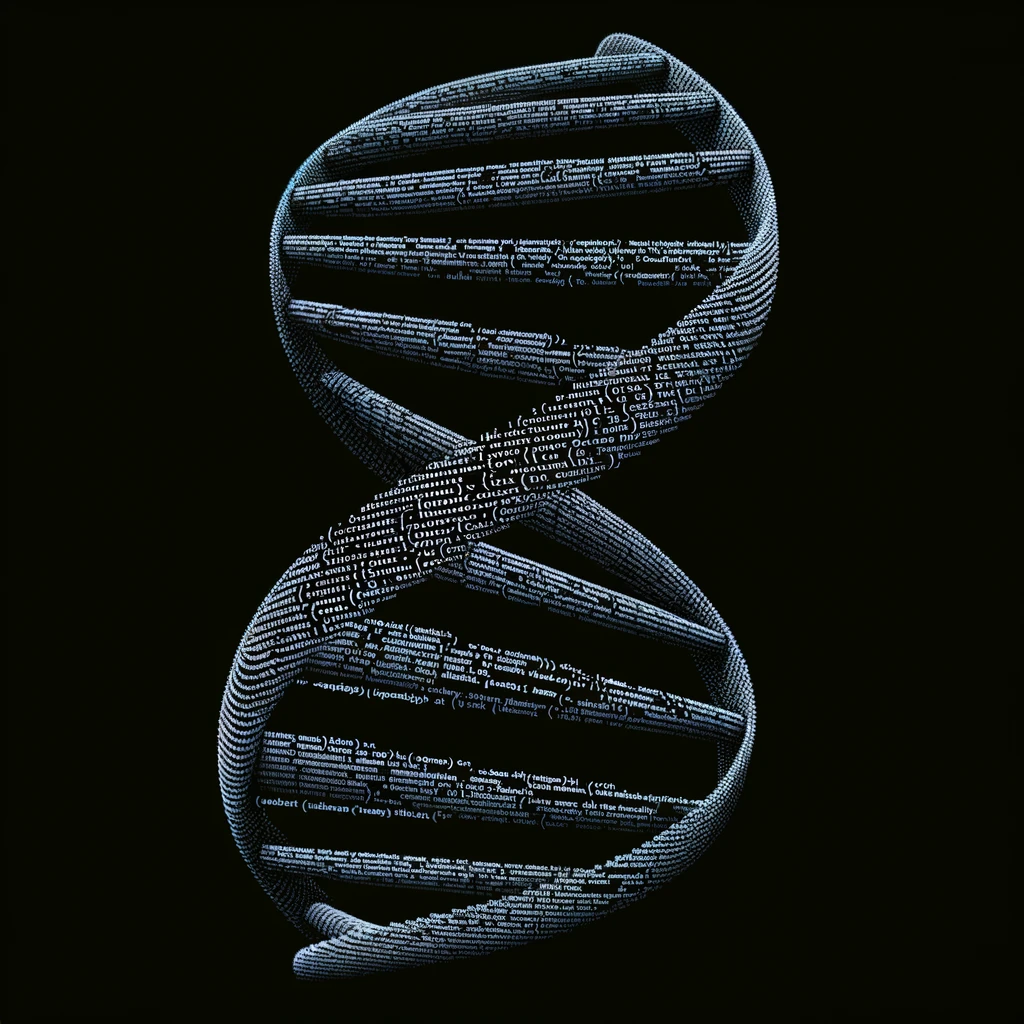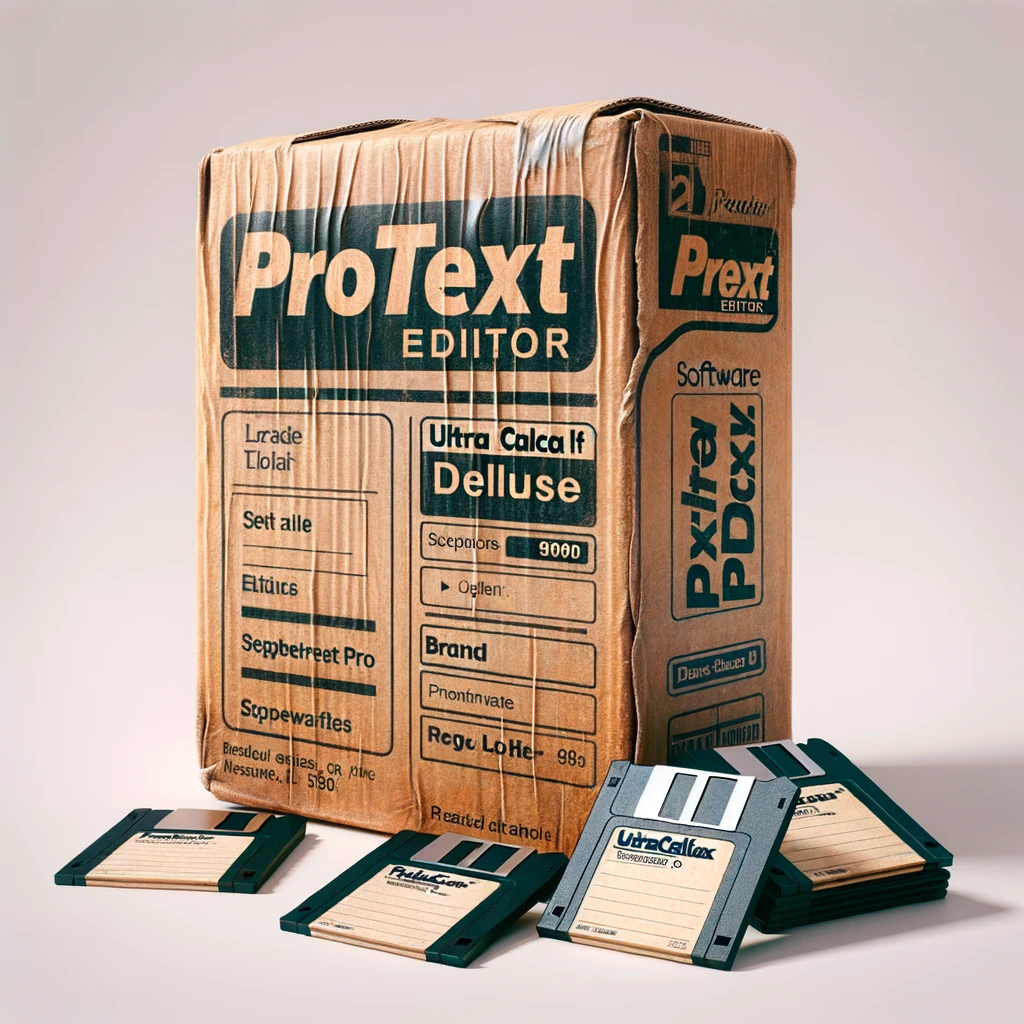Der Verstoß gegen Sanktionen („Embargoverstoß“) ist mit erheblichen Sanktionen bewehrt – und gerade in den vergangenen Monaten keineswegs ein so exotischer Verstoß, dass man ihn nicht auf dem Schirm haben müsste. Wir sind in unserer Kanzlei in den vergangenen Monaten vorwiegend mit Beratungsanfragen konfrontiert im Bereich Software und Technologie-Güter, bei denen sich die Frage einer Einfuhr bzw. Ausfuhr über durchaus trickreiche Umwege stellt.
Verstoß gegen Sanktionen weiterlesenSchlagwort: AGG
Einsichtnahme in Quellcode bei IT-Vergabe
Das Oberlandesgericht Düsseldorf, Verg 25/18, konnte ich in einem interessanten Fall dazu äußern, wie umfangreich das Angebot an Informationen im Rahmen einer Ausschreibung sein muss, wenn es um die (Weiter-)Entwicklung und Pflege einer Software geht:
Zwar genügt die Zurverfügungstellung des Quellcodes allein auch nach dem Vorbringen der Antragsgegnerin nicht, um Unternehmen, die die Software nicht entwickelt haben, bei Folgevergabeverfahren, die die Pflege, Anpassung oder Weiterentwicklung der Software zum Gegenstand haben, transparent, gleich und nicht diskriminierend zu behandeln. Die Antragsgegnerin hat jedoch bereits mit der Folgeausschreibung „Anpassung, Inbetriebnahme und Softwarepflege des Einsatzleitsystems XX. bei der Berufsfeuerwehr …“ dokumentiert, dass sie sich nicht auf die Zurverfügungstellung des Quellcodes beschränken will. Vielmehr hat sie dort ihre Bereitschaft erkennen lassen, alle notwendigen Informationen – zum Beispiel auch die Dokumentation des Quellcodes – zur Verfügung zu stellen, die es braucht, um den Wettbewerbsnachteil, der sich für Drittunternehmen daraus ergibt, dass sie die Software nicht entwickelt haben und daher mit dem Quellcode (noch) nicht vertraut sind, in dem für einen wirksamen Wettbewerb erforderlichen Umfang auszugleichen. Mit dieser Bereitschaft ist den Anforderungen des Besserstellungsverbots hinsichtlich des streitbefangenen Beschaffungsvorgangs Genüge getan. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs muss der öffentliche Auftraggeber dafür sorgen, dass er den potenziellen Bewerbern und Bietern hinreichende Informationen übermittelt, um die Entwicklung eines wirksamen Wettbewerbs auf dem abgeleiteten Markt der Pflege, der Anpassung oder der Weiterentwicklung der Software zu ermöglichen (EuGH, Urteil vom 28. Mai 2020 – C-796/18, zitiert nach juris, Rn. 74). Das bezieht sich auf den Quellcode und gegebenenfalls auch weitere notwendige Informationen (vgl. EuGH, Urteil vom 28. Mai 2020 – C-796/18, zitiert nach juris, Rn. 75). (…)
Die Frage, welche Informationen zur Ermöglichung wirksamen Wettbewerbs zu übermitteln sind und der Einräumung welcher Fristen es bedarf, um ihre Auswertung zu ermöglichen, hängt von den konkreten Umständen des Einzelfalls ab und ist vom öffentlichen Auftraggeber nach pflichtgemäßem Ermessen zu entscheiden (…).
Einerseits muss nicht jedes durch Voraufträge erworbene Know-how ausgeglichen werden (vgl. z.B. OLG Bremen, Beschluss vom 9. Oktober 2012 – Verg 1/12, zitiert nach juris, Tz. 116 [bezogen auf Software]; OLG Naumburg, Beschluss vom 5. Dezember 2008 – 1 Verg 9/08, zitiert nach juris, Tz. 79; Voigt, in: Müller-Wrede, VgV/UVgO, § 7 VgV Rn. 32).
Andererseits ist wirksamer Wettbewerb zu gewährleisten, so dass außer der Übermittlung ausreichender Informationen auch das Einräumen angemessener Fristen zur Auswertung derselben wichtig ist. (…) Die Pflicht des öffentlichen Auftraggebers, den Unternehmen, die die Software nicht entwickelt haben, hinreichende Informationen zur Ermöglichung wirksamen Wettbewerbs auf dem nachgelagerten Markt der Pflege, Anpassung oder Weiterentwicklung der Software zu übermitteln, besteht erst in den Vergabeverfahren, die diese Leistungen betreffen.
Aktualisierungspflicht für Software
Pflicht zur Bereitstellung von Aktualisierungen („Updatepflicht“) bei Software: Seit dem 1.1.22 haben wir ein EU-weit normiertes Verbraucher-Softwarerecht. Mit diesem Softwarerecht kommt ein besonderes Novum: die gesetzliche Vorgabe einer Updatepflicht für Software.
Aktualisierungspflicht für Software weiterlesenBei Verkauf technischer Geräte kein Hinweis auf bestehende Sicherheitslücken nötig
Beim Oberlandesgericht Köln (6 U 100/19) ging es um die Frage, ob beim Verkauf von Smartphones auf im Rahmen des Betriebssystems bestehende Sicherheitslücken und fehlende Sicherheitsupdates hingewiesen werden muss. Die Entscheidung ist Wichtig, inhaltlich durchaus richtig – und offenbart zugleich kritisch zu hinterfragende Probleme im Umgang mit der Cybersicherheit.
Passend dazu: Verkäufer muss nicht auf bald bevorstehenden Modellwechsel hinweisen
Bei Verkauf technischer Geräte kein Hinweis auf bestehende Sicherheitslücken nötig weiterlesenSoftware: Anspruch auf Übergabe von Quelltext
Besteht ein Anspruch auf Überlassung des Quelltextes: In seiner bisher wohl einzigen Entscheidung zur Frage, ob bei einer im Rahmen eines Werkvertrages erstellten Software der Quelltext zu überlassen ist, hat sich der Bundesgerichtshof (X ZR 129/01) differenziert geäußert.
Software: Anspruch auf Übergabe von Quelltext weiterlesenUrheberrechtliche Auswirkungen eines AdBlockers
Das Landgericht Hamburg (308 O 244/16) hatte 2016 entschieden, dass es einen Unterlassungsanspruch einer Nachrichtenseite gegen einen Adblocker gibt – allerdings wurde ein solcher nicht auf urheberrechtlicher, sondern nur auf wettbewerbsrechtlicher Grundlage zugestanden.
Zu den urheberrechtlichen Fragen hatte das Landgericht ausgeführt, dass eine Umarbeitung der Steuerungssoftware der Webseiten der Antragstellerin i.S.d. § 69c Nr. 2 UrhG nicht anzunehmen sei. Die Antragstellerin habe seinerzeit einen Eingriff in die Substanz des Programms nicht glaubhaft gemacht. Auch eine unzulässige Vervielfältigung des Programms sei nicht gegeben. Die Antragstellerin gestatte es den Nutzern ihres Internetauftritts gerade ohne Einschränkung hinsichtlich der Nutzung von Werbeblockern, ihr Programm in ihrem – der Nutzer – Arbeitsspeicher abzulegen.
Später dann, im Jahr 2018, hatte sich das Hanseatische Oberlandesgericht Hamburg (5 U 46/17) damit zu beschäftigen, konnte dazu aber nichts weiter ausführen, da der von der Antragstellerin ursprünglich auf die Verletzung von Urheberrechten gestützte Verfügungsanspruch vom Landgericht (formell) rechtskräftig zurückgewiesen worden und dementsprechend nicht Gegenstand des Berufungsverfahrens geworden war. Auch der Bundesgerichtshof (I ZR 154/16) konnte sich damit beschäftigen, stellte am Rande fest, dass wohl keine grundsätzlichen urheberrechtlichen Bedenken bestehen und jedenfalls ein wettbewerbsrechtlicher Unterlassungsanspruch nicht zu erkennen ist:
- Das Angebot einer Software, die Internetnutzern ermöglicht, beim Abruf mit Werbung finanzierter Internetangebote die Anzeige von Werbung zu unterdrücken, ist keine unlautere zielgerichtete Behinderung im Sinne des § 4 Nr. 4 UWG. Dies gilt auch, wenn das Programm die Freischaltung bestimmter Werbung solcher Werbetreibender vorsieht, die dem Anbieter des Programms hierfür ein Entgelt entrichten.
- Das Angebot einer Werbeblocker-Software stellt auch keine aggressive geschäftliche Handlung im Sinne des § 4a Abs. 1 UWG gegenüber den Unternehmen dar, die an der Schaltung von Werbung interessiert sind.
Insgesamt wird damit eine grundsätzliche Zulässigkeit von Adblocker-Sofware im Raum stehen.
Zur Mangelhaftigkeit von Software bei ungenügender Dokumentation
Softwarerecht: Beim Oberlandesgericht Frankfurt am Main (5 U 152/16) stritt man um die Mangelhaftigkeit einer Softwarelösung, die mittels agiler Entwicklung entwickelt wurde. Der Auftraggeber bemängelte eine unzureichende Dokumentation einmal der Software insgesamt, aber auch hinsichtlich einer (vereinbarten) Kommentierung des Software-Quelltextes.
Das Gericht macht deutlich, dass eben auch eine „äußerst knappe“ Kommentierung des Quelltextes ausreichend sein kann; etwas anderes gilt, aber bei der Dokumentation der Systemarchitektur – hier kann eine mangelnde Dokumentation insbesondere dann problematisch sein, wenn hierdurch verhindert wird, dass ein fachkundiger Dritter sich in das Projekt einarbeiten und dieses fortführen kann, die Leistung kann damit für den Auftraggeber unbrauchbar und letztlich wertlos sein. Hier aber schlägt die vereinbarte agile Softwareentwicklung durch, wie auch das OLG bestätigt: Eine solche Dokumentation ist erst dann sinnvoll möglich, wenn die Systemarchitektur und die letztendlich verwendeten Komponenten überhaupt feststehen – das ist während eines laufenden und „mittendrin“ gescheiterten Projekts – anders als bei den Quelltextdateien – kaum sinnvoll möglich.
Angesichts der 6-stelligen im Streit stehenden Summe ein für den Auftraggeber unerfreuliches Ergebnis, das durchaus gewisse Tücken agiler Entwicklung dokumentiert: Softwareprojekte, gerade die besonders umfangreichen, entwickeln sich durchaus gerne für alle Beteiligten recht unerfreulich. Bei agiler Entwicklung besteht an dieser Stelle eine gewisse Unsicherheit, wenn das Projekt wie so oft „mittendrin“ abgebrochen wird – der Auftraggeber möchte dann ein zumindest irgendwie verwertbares Ergebnis, der Auftragnehmer seinen Aufwand angemessen vergütet sehen. Bei zunehmendem Streit driftet diese Schere von Ansprüchen immer weiter auseinander, dem vertraglich zu begegnen ist bei agiler Entwicklung ebenso trickreich wie mit Tücken versehen.
Mitwirkung des Softwareerstellers bei Erstellung des Pflichtenheftes
Enthält ein Pflichtenheft zu einzelnen Fragen der Gestaltung von Dateneingaben keine hinreichend klaren Vorgaben, so entbindet dies den Softwarehersteller nicht von der Verpflichtung, die diesbezüglichen Wünsche und Vorstellungen des Auftraggebers zu erfragen und mit diesem eine verbindliche Klärung herbeizuführen.
Denn die Erstellung eines möglichst umfassenden Pflichtenheftes ist nicht einseitig Sache des Anwenders; auch der Anbieter von Software und sonstigen EDV-Produkten hat daran mitzuwirken. Er muß z.B. von sich aus die innerbetrieblichen Anforderungen ermitteln, auf deren Fixierung in einem Pflichtenheft durch den Anwender drängen, für ihn erkennbare Unklarheiten und Bedürfnisse aufklären, bei der Formulierung des Pflichtenheftes mitwirken und einen organisatorischen Vorschlag zur Problemlösung unterbreiten. All dies ergibt sich aus dem Know-how des Anbieters und seiner in der Regel größeren Erfahrung im Software- und EDV-Bereich. Kommt der Anbieter dieser Pflicht nicht nach, so haftet er, wenn es einem System oder Programm an der erforderlichen Einfachheit und Eignung für die individuellen Bedürfnisse des Anwenders fehlt (so Oberlandesgericht Köln, 19 U 228/97).